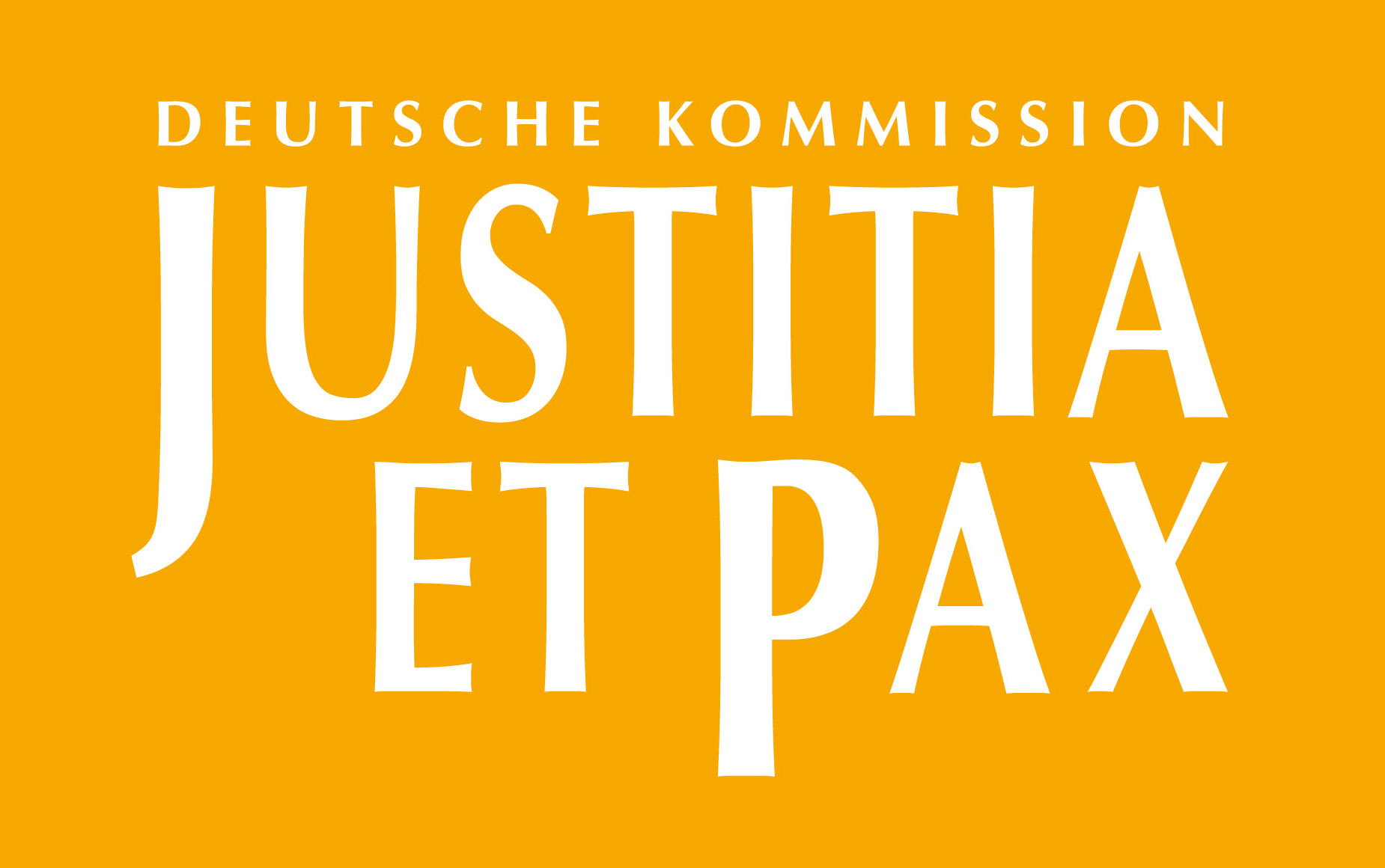Schwere Wege zur Versöhnung in Russland und der Ukraine
25.06.2025
Beim 4. Ökumenischen Friedensdialog in Münster sprachen Dr. Irina Scherbakowa (Gründungsmitglied von Memorial), Myroslav Marynovych (Präsident des Institute of Religion and Society der Ukrainian Catholic University, Lviv), Landesbischof Friedrich Kramer (Friedensbeauftragter des Rates der EKD) und Erzbischof Dr. Udo Markus Bentz (Vorsitzender der Deutschen Kommission Justitia et Pax) über Möglichkeiten und Grenzen von Versöhnungsprozessen nach Kriegen
4. Ökumenischer Friedensdialog in Münster: Schwere Wege zu Versöhnung in Russland und der Ukraine
Versöhnungsprozesse zwischen der Ukraine und Russland scheinen derzeit in weiter Ferne zu liegen. Davon sind sowohl die russische Menschenrechtlerin Dr. Irina Scherbakowa wie auch der ukrainische Wissenschaftler Myroslav Marynovich überzeigt. Der Vorsitzende der Deutschen Kommission Justitia et Pax, Erzbischof Dr. Udo Markus Bentz, und der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Friedrich Kramer, unterstrichen allerdings beim Ökumenischen Friedensdialog in Münster, dass es trotz aller Schwierigkeiten wichtig sei, auch schon im Krieg über Frieden nachzudenken und erste Schritte zu gehen.
Wie können Versöhnungsprozesse nach Kriegen gelingen? Vor allem, wie können Versöhnungsprozesse während eines Krieges wie dem in der Ukraine begonnen werden? Das waren die Fragen, die im Mittelpunkt dieses Ökumenischen Friedensdialoges standen, zu dem die Deutsche Kommission Justitia et Pax und die Evangelische Friedensarbeit im Raum der EKD eingeladen hatte.
„Ich sehe derzeit keine Voraussetzung für eine Versöhnung“, bedauerte Myroslav Marynovich in Münster. „Wir leben mitten im Krieg“, machte er deutlich. Putin gehe es darum, die Ukraine zu unterwerfen. Wenn es überhaupt zu einer Versöhnung kommen könne, dann müssten dazu die besetzten ostukrainischen Gebiete wieder befreit sein, die Grenzen von 1991 gelten, das russische Regime zur Rechenschaft gezogen und Wiedergutmachungen gewährt werden. Doch da sehe er derzeit keine realistischen Möglichkeiten, bedauerte er, obwohl sein Land so dringend Frieden bräuchte.
„Ich glaube überhaupt nicht an eine Möglichkeit der Versöhnung“, bekräftigte auch Irina Scherbakowa, die Mitbegründerin von „Memorial“, die derzeit in Deutschland im Exil lebt. „Dieser Krieg ist, was Versöhnung angeht, tragischer und schrecklicher als etwa die Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich oder Deutschland und Polen. Versöhnung ist hier unglaublich schwer, weil es hier um einen Krieg geht, der Familien und Freundschaften zerstört. Versöhnung kann es nur unter den Bedingungen eines gerechten Friedens geben“, machte sie deutlich, räumte aber direkt ein: „Solange Putin im Kreml sitzt, glaube ich keinen Augenblick an einen gerechten Frieden.“
Düstere Einschätzungen, die nicht ohne Eindruck blieben in Münster. „Es ist schwer, das zu hören. Doch als Kirche und als Christinnen und Christen sind wir dennoch aufgefordert, einen weiten Horizont aufzumachen“, gab Friedrich Kramer, der EKD-Friedensbeauftragte und Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, zu bedenken. Er befürchte, dass bis zu einer Versöhnung hier noch ein sehr weiter Weg sei. Doch zeigte sich der EKD- Friedensbeauftragte überzeugt, dass trotz allem kein Weg daran vorbeiführe, Dialoge in Gang zu bringen und sich wechselseitig den Schmerz zuzumuten. „Das könnte ein erster Schritt Richtung Versöhnung sein“, so Kramer.
Als Außenstehende und Mitfühlende müsse man vorsichtig mit großen Worten von Versöhnung und Frieden sein, und dennoch alles dafür tun, dass die Waffen schweigen, räumte auch der Paderborner Erzbischof Dr. Udo Markus Bentz, der Vorsitzende der Deutschen Kommission Justitia et Pax, in Münster ein. „Auch wenn noch keine Lösung am Horizont zu sehen sei, schon Schritte gehen, um etwas zu ermöglichen. Das sei noch lange kein Frieden. Aber dazu braucht es langen Atem und Geduld. Und Menschen, die den Mut haben, das anzusprechen“, so Erzbischof Bentz.
Irina Scherbakowa warnte allerdings vor einer Blauäugigkeit gegenüber Russland. „Es ist ein Aggresssions- und Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Auch darüber müssten wir reden, wenn es um Versöhnung geht“, unterstrich sie nachdrücklich und warnte vor Wegschauen und Flucht vor der Realität. Auch Myroslav Marynovich wies darauf hin, dass über viele Jahre hinweg immer wieder versucht worden sei, Russland zu beschwichtigen. „Stattdessen wäre es nötig gewesen, Russland Einhalt zu gebieten“, betonte er. Diese Beschwichtigungen seien von Putin als Angst und damit als Grundlage für eine Eskalation interpretiert worden. Dennoch sah er auch positive Entwicklungen. „Als ich 1977 in sowjetischer Lagerhaft war, wusste ich, dass die Sowjetunion untergehen würde. Auch jetzt rieche ich das Ende des Regimes. Denn Gewalt, Hass und Lügen können keine Grundlage für eine neue Weltordnung sein“, machte er in Münster deutlich. Und Irina Scherbakowa betonte dann aber doch die Notwendigkeit, über Versöhnung zu reden, auch wenn derzeit nichts dafür spreche. „Die Ukraine darf nicht verlieren, Russland nicht gewinnen. Und auch die russisch-orthodoxe Kirche muss ihre Schuld anerkennen, wenn Versöhnung möglich werden soll“, unterstrich sie.
„Wir wissen, dass nicht zu jedem Zeitpunkt Frieden und Versöhnung möglich sind, sondern dass dafür Stabilität und Sicherheit nötig sind“, so Erzbischof Udo Markus Bentz. Und er glaube auch, dass erst unter massivem Druck von außen die Waffen schweigen würden, so wie jetzt in Israel und im Nahen Osten, auch wenn er derzeit nicht erkenne, wer diesen Druck ausüben könne, räumte er ein. Erst wenn die Waffen schwiegen, könne man von Hoffnung sprechen und von Versöhnung. „Das kann Jahrzehnte dauern, aber noch nie hat ein Unrechtsregime auf Dauer mit seinem Unrecht Erfolg gehabt“, gab er zu bedenken und machte deutlich: „Frieden ist nicht nur unser Tun, es ist auch ein Geschenk.“ Und Landesbischof Friedrich Kramer verwies auf den Westfälischen Frieden, der eine Hoffnungsgeschichte sei. „Wir brauchen langen Atem. Aber ich weiß, dass letztendlich den Menschen die Friedenssehnsucht ins Herz gepflanzt ist. Das ist meine Hoffnung.“
Seit 2021 laden die Deutsche Kommission Justitia et Pax und die Evangelische Friedensarbeit regelmäßig zu diesem Friedensdialog ein. Die Veranstaltung wechselt jährlich zwischen Osnabrück und Münster, den beiden Städten, in denen Gesandte der europäischen Mächte um das Ende des Dreißigjährigen Krieges verhandelten und zwischen denen fünf Jahre lang Friedensreiter pendelten. Orte, in denen Friedensgeschichte geschrieben wurde. „Wir in Münster sind hier diesem Erbe verpflichtet. Und der Friedensdialog ist ein Weg, dies auch in die Gesellschaft zu tragen“, betonte Maria Winkel, die Bürgermeisterin von Münster.
Hier geht es zur Pressemitteilung als pdf.